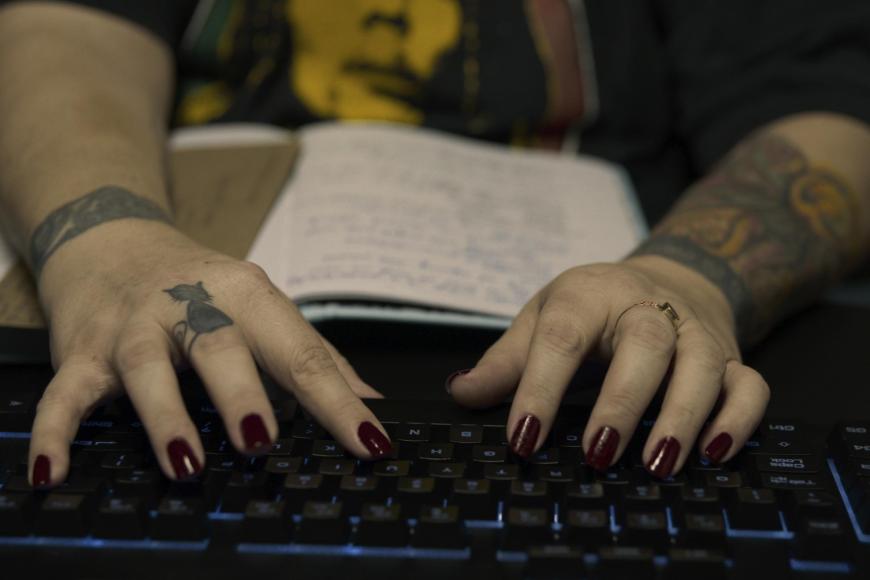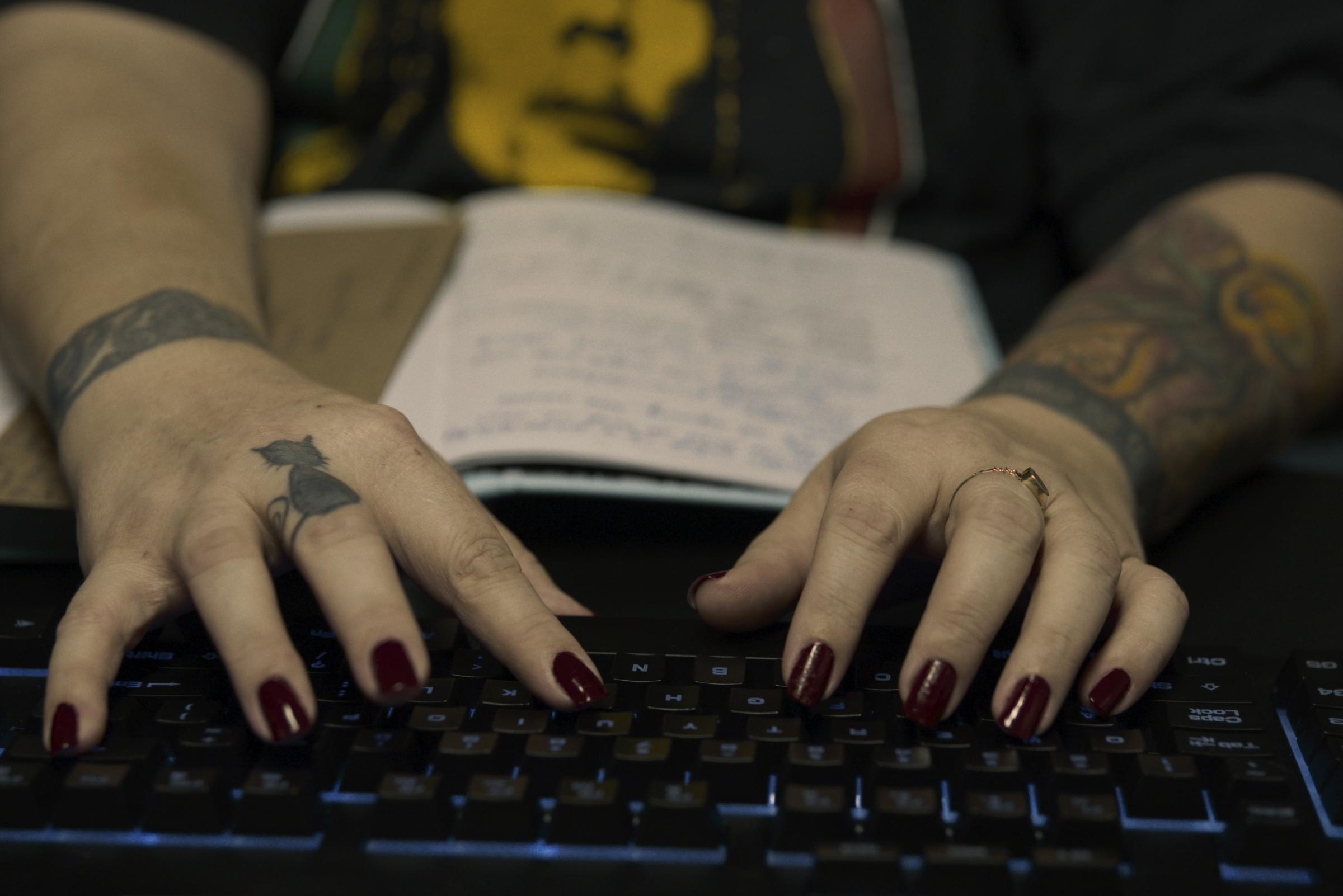Dokumentarfilm über den Chaos Computer Club und die Themen Datenschutz, Überwachung und Demokratie
Altersempfehlung: ab 14 Jahre
Klassenstufen: ab 9. Klasse
Themen: Internet, Computer, Digitalisierung, Demokratie, Utopie, Fantasie, Idealismus, Meinungs- und Pressefreiheit, Diversität
Lehrplanbezüge: Politik und Medien, Digitalisierung, Datenschutz
Unterrichtsfächer: Informatik, Gemeinschaftskunde, Politik, Ethik, Religion, Deutsch, Geschichte, Musik, Kunst
Zum Inhalt
Der Chaos Computer Club (CCC) ist weit mehr als eine Vereinigung von Nerds und Hackern. Seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren agiert der CCC als Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Inzwischen wird sogar die Bundesregierung in Digitalisierungsfragen vom CCC beraten. Längst sind die Aktivisten zu anerkannten Experten für Themen wie Datenschutz, Netzneutralität, Zensur und Massenüberwachung geworden.
Immer wieder weist der CCC darauf hin, wie unverzichtbar es ist, die Digitalisierung aller Lebensbereiche kritisch zu begleiten und ihre Folgen – seien sie intendiert oder nicht – zu reflektieren. Zentraler Grundsatz des Chaos Computer Clubs ist die Freiheit von Wissen und Information auf der Basis demokratischer Entscheidungen. Jedes Jahr organisiert der CCC diverse Arbeitscamps und internationale Kongresse, um für ein paar Tage die Utopie einer radikal demokratischen Welt ohne Wissensgrenzen Wirklichkeit werden zu lassen. Seit 2017 findet der jährliche Kongress in Leipzig statt. Die Tickets sind immer Monate vorher ausverkauft.
Der vorliegende Dokumentarfilm ist ein verspielter und höchst informativer Versuch, die anarchische Vielfalt der Lebensformen zu beschreiben, die sich in den Hacker-Camps oder auf den Kongressen trifft. Wir blicken den Nerds, politischen Aktivistinnen und Aktivisten und „anderen galaktischen Lebensformen“ über die Schulter und erleben – ergänzt durch kurze
Animationssequenzen – was es heißt, die Gesellschaft nicht als gegebene Tatsache, sondern als gestaltbares Material zu betrachten, das es zu „hacken“ gilt. Ohne Glorifizierung, dafür mit viel Sinn für die inneren Widersprüche zeichnet der Film das Bild einer sehr eigenen (Sub-)Kultur, deren Themen längst zum Mainstream geworden sind.