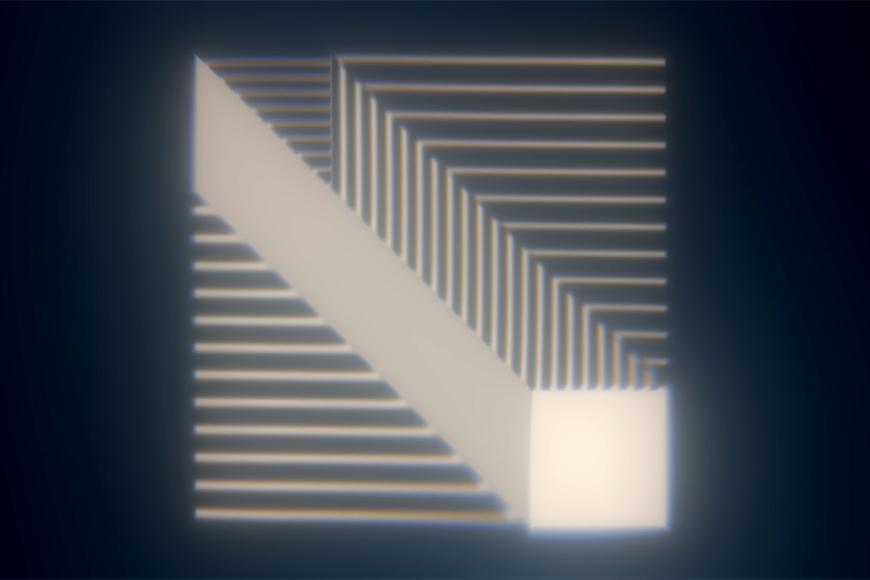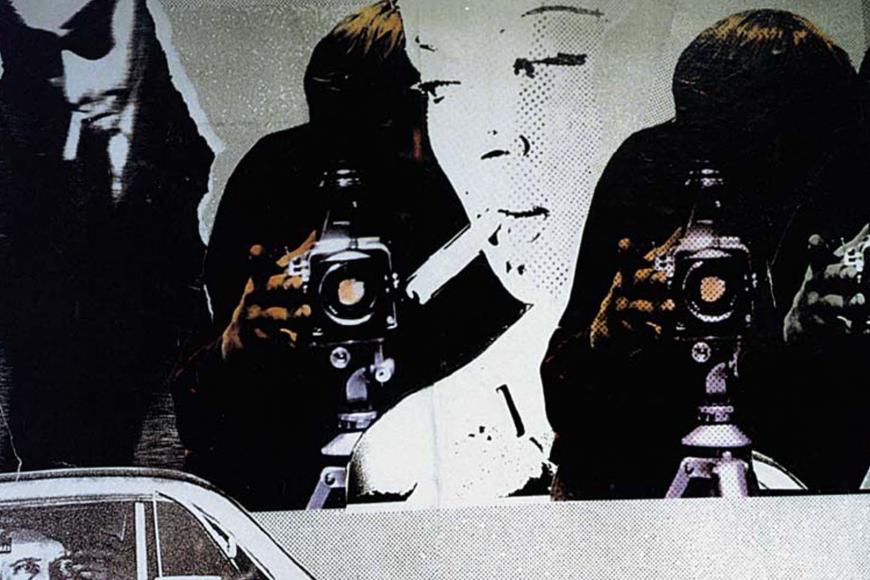¡Huelga!
1965 fand in Delano in Kalifornien der bis dato längste Farmarbeiter*innenstreik der US-amerikanischen Geschichte statt. Unter der Führung von Cesar Chavez erstritten sich bis dahin unorganisierte mexikanische Saisonkräfte bessere Arbeitsbedingungen und das Recht auf Gründung einer eigenen Gewerkschaft, der National Farm Workers Association (NFWA). „¡Huelga!“ ist das parteiische Porträt einer entstehenden Solidargemeinschaft, die sich nicht nur gegen den regellosen Kapitalismus im Agrarsektor stemmte, sondern auch dem Rassismus der weißen Landbesitzer*innen den Kampf ansagte. Neben der Schilderung von Mechanismen des Streiks legt die bewegliche Kamera auch Wert auf die Dokumentation unwürdiger Lebensverhältnisse von Menschen, die eine der mächtigsten Industrien des Landes am Laufen hielten.

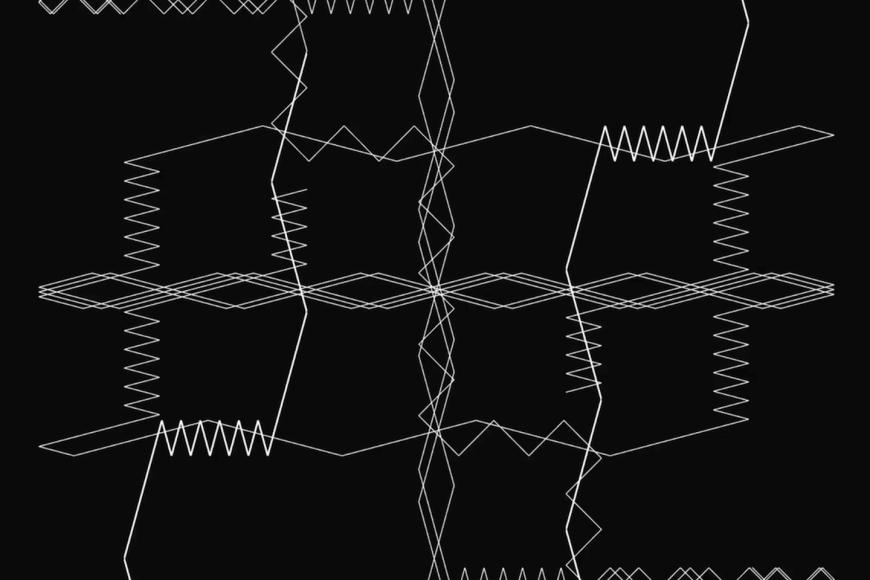
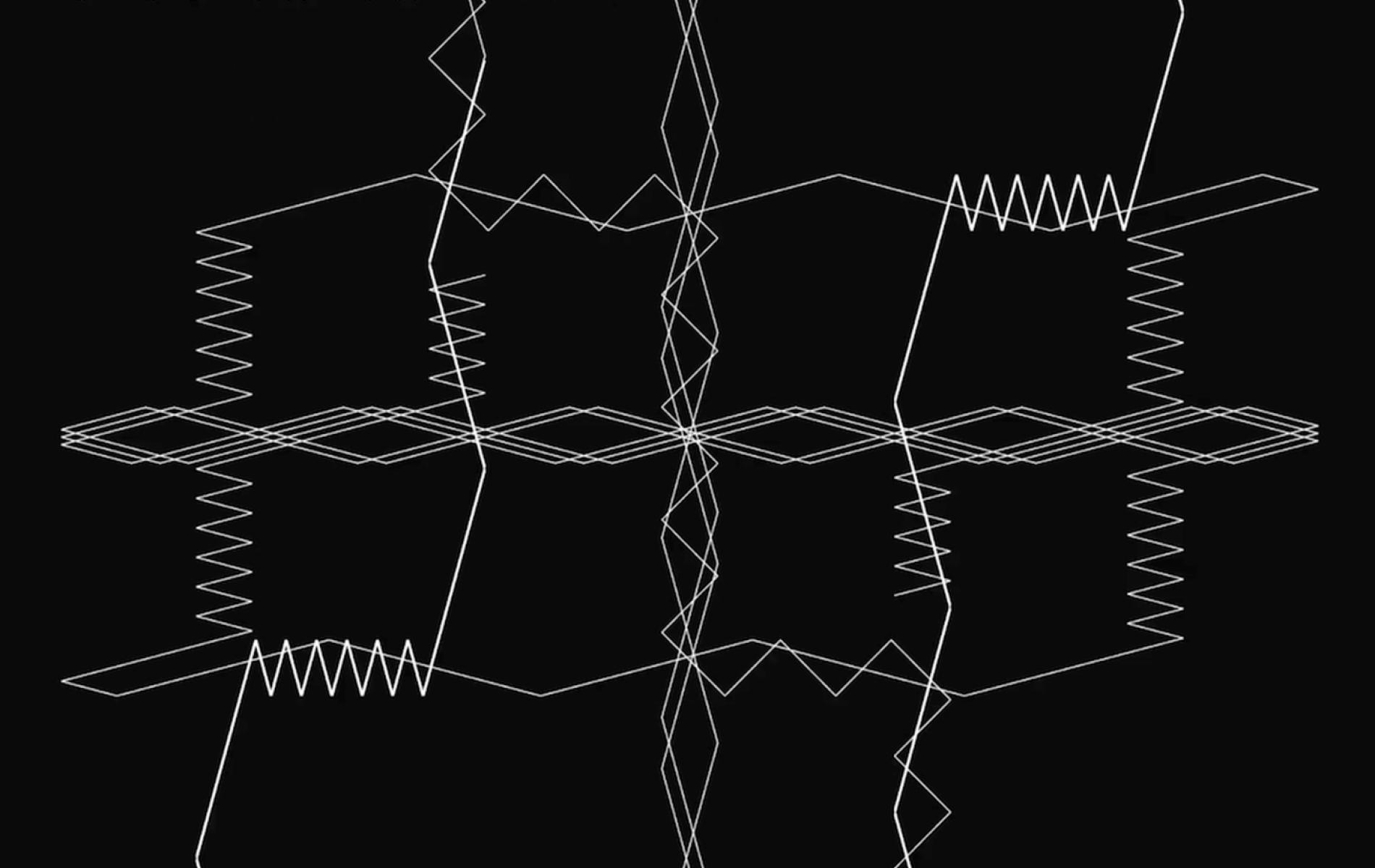



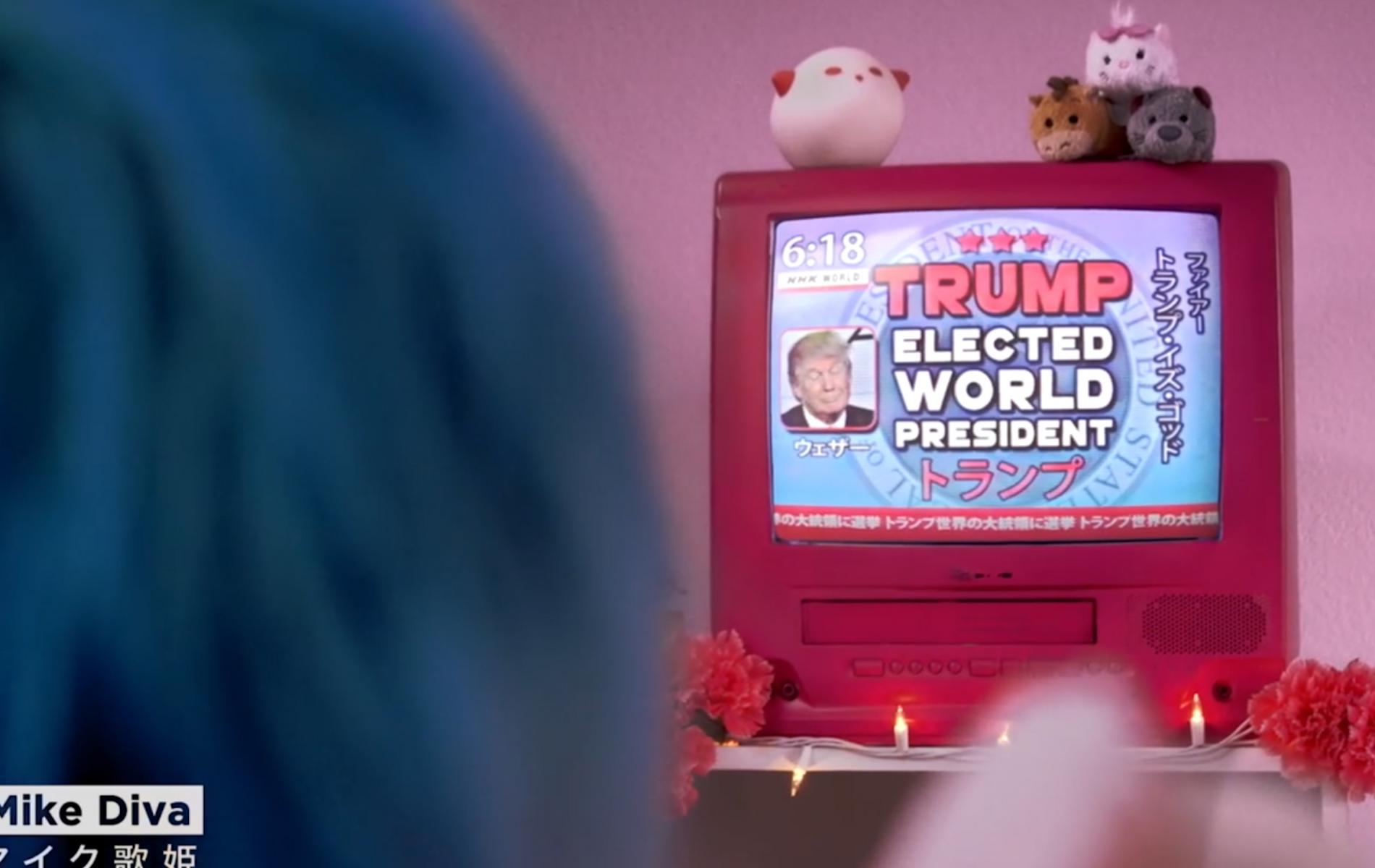
![Filmstill [Opening speech for the retrospective “Cuban Documentary Film”] [excerpt]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/87e27ec7-a5fa-4f0c-bacb-21a6b6cbc8ec.jpg?h=e23cd095&itok=YShdmdTq)
![Filmstill [Opening speech for the retrospective “Cuban Documentary Film”] [excerpt]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/87e27ec7-a5fa-4f0c-bacb-21a6b6cbc8ec.jpg?h=e23cd095&itok=u3tyNSAe)
![Filmstill [An Interview with Ingeborg Tölke]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/6ff3c370-f0ce-42a3-a57e-4f37f285b500.jpg?h=10d202d3&itok=ucGPR2ad)
![Filmstill [An Interview with Ingeborg Tölke]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/6ff3c370-f0ce-42a3-a57e-4f37f285b500.jpg?h=10d202d3&itok=GSNeT1JY)
![Filmstill [Kurt Biedenkopf visits a Soviet tank regiment]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/45138e5f-4fbb-4495-ad4b-2042f249e46f.jpg?h=e66719d7&itok=vJgnCPmq)
![Filmstill [Kurt Biedenkopf visits a Soviet tank regiment]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/45138e5f-4fbb-4495-ad4b-2042f249e46f.jpg?h=e66719d7&itok=mQnZG5pZ)


![Filmstill [Posthuman Wombs]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/070b020f-bb2b-4c5b-914f-7021939da925.jpg?h=131411b1&itok=zWlX1Cfz)
![Filmstill [Posthuman Wombs]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/070b020f-bb2b-4c5b-914f-7021939da925.jpg?h=131411b1&itok=uU3ALwiJ)
![Filmstill [Sierra Leone]](/sites/default/files/styles/stepped_teaser_/public/fiona/films/stills/c1b8736d-6a68-43e6-8099-84d4ab26cccf.png?h=d1cb525d&itok=4RomqN0Q)
![Filmstill [Sierra Leone]](/sites/default/files/styles/film_stills_full_content_view/public/fiona/films/stills/c1b8736d-6a68-43e6-8099-84d4ab26cccf.png?h=d1cb525d&itok=iXFwU7Yw)